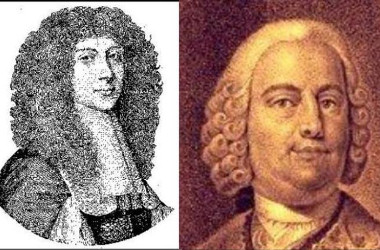Carl Heinrich Graun
Heimat
In unserem kleinen Städtchen Wahrenbrück, wurde am 07. Mai 1701 (nach Cantor Wießner und Prof. Dr. Erdmann Preuß u.v.a.) Carl Heinrich Graun geboren. Das ist falsch, denn J.D.E. Preuß schreibt selbst in seinem Werk "Friedrich der Große - Eine Lebensgeschichte", Karl Heinrich Graun war 25 Jahre Kapellmeister, und starb 1759 d. 8. August, 55 Jahre alt, in Berlin. Demnach wurde Graun 1704 geboren. Dies bestätigen auch die Bestattungsbücher von St. Nikolai bzw. St. Petri. Sein Vater war August Graun der von 1690 bis 1735 als Königlicher Sächsischer Accis- und Geleits-Einnehmer in Wahrenbrück arbeitete. Er ehelichte Anna Margaretha geborene Schneider, die aus Wahrenbrück stammte und hatte 3 Kinder mit ihm: August Friedrich, Johann Gottlieb und Carl Heinrich. Sie studierten Musik und hatten alle drei bedeutende Ämter. August Friedrich war als Cantor und College des Stiftgymnasiums zu Merseburg tätig er ist 1765 gestorben, Johann Gottlieb arbeitete als Königlich Preußischer, resp. Hof-Capellmeister und Director Musices er starb am 27. Oktober 1771 in Berlin, Carl Heinrich war der dritte Sohn und starb am 8. Auguſt 1759. Ihre Dankbarkeit und Verbundenheit zu Wahrenbrück bewiesen sie als sie alle drei 1736 ihren ehemaligen ersten Lehrer den Cantor in Wahrenbrück, Magister Johann David Cocler zu ihrem General-Bevollmächtigten machten.
Ausbildung
1713 brachte der Vater die beiden jüngsten Söhne nach Dresden auf die Kreuzschule zur Ausbildung in der Tonkunst, der ältere Bruder war schon dort. Der kleine Carl Heinrich zeichnete sich bald durch seine liebliche Stimme und durch sein freundliches, liebevolles Wesen aus, weswegen er in Kürze einer der beiden Rathsdiskantisten wurde und bei den Kirchenmusiken mitwirkte. In jener Zeit war die Kreuzschule in Dresden eine der bedeutendsten Ausbildungsstätten für die Oper in Deutschland. Hier erhielten sie eine solide Ausbildung und durch ihre Begabung entstanden Freundschaften wie mit dem Lautenisten Weiß und dem Flötisten Quantz. Mit den Beiden war er 1723 auf einer Musikalischen Reise nach Prag unterwegs um hier bei der Krönung Kaiser Carls VI. der Aufführung der großen Oper „Constanz e Fortezza“ von Fuox, die unter freiem Himmel von 100 Sängern und 200 Instrumentisten erfolgte, mitwirken und beiwohnen zu können. Als er zwei Jahre darauf als Tenorist nach Braunschweig kam, erhielt er für seine Compositionen den Titel eines Vice-Kapellmeisters. Hier lernte er Friedrich den Große, der sich als Kronprinz bei seiner Vermählung in Braunschweig aufhielt, bei der Aufführung der von ihm komponierten Oper „Timarete“ kennen und schätzen.
Anstellung
Er bat seinen Schwiegervater, ihm den Graun für seine Rheinsberger Capelle mit zugeben. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt und von dieser Zeit an finden wir die beiden Männer in treuster Verbundenheit und gemeinsamen Streben bis zum Tode vereint. In Rheinsberg hat Graun dem Kronprinz Unterricht in der Kompositionslehre erteilt und ihn durch Vorsingen mit seiner schönen Tenorstimme erfreut. Außerdem beschäftigte er sich mit der Komposition von fast 50 Cantaten, wozu Friedrich sehr oft den Text in französischer Sprache beisteuerte. 1739 reiste Graun auf Befehl des Kronprinzen nach Dresden, was vermuten lässt, dass von dort für die Rheinsberger Capelle noch einiges zu holen war. Der Weg führte ihn auch nach Wahrenbrück, sein Vater war bereits drei Jahre Tod, die Mutter lebte noch und wohnte im Auszugshaus, das Haus hatte sie an den Bürgermeister Arnold verkauft. Im Jahre 1746 ist auch die Mutter im 83. Lebensjahr verstorben. 1740 wurde sein Herr und Freund König von Preußen, das Begräbnis dessen Vater König Friedrich Wilhelm I. stand bevor und Graun sollte das Oratorium zum Leichenbegräbnis des verstorbenen Monarchen aufführen. Ein wahrlich schweres Unterfangen da ihm nur ein paar Querpfeifer der Grenadier-Garde aus Potsdam zur Verfügung standen, nachdem ihn das weder Schlecht noch Recht gelungen war fuhr er nach dem Willen seines jetzigen Königs nach Italien, um in Bologna, Venedig, Florenz, Rom und Neapel Sänger und Sängerinnen anzuwerben. Hier fand er als Sänger und Komponist großen Zuspruch und kam mit einer ausreichenden Zahl italienischer Künstler in Berlin an. Im darauf folgenden Jahr am 13. Dezember führte er seine erste Berliner Oper „Rodelinda Regina dei Longobardi“ mit den italienischen Künstlern auf dem kleinen Schlosstheater auf. Der König unterstützte Graun persönlich dabei und sprach von einem großen Erfolg. Im Jahre 1742 wurde das von Knobelsdorf erbaute Opernhaus am 7. Dezember mit der Graun'schen Oper „Cesare e Cleopatra“ eröffnet. Die Idee zum Text hatte der König dem Hofpoeten Bottarelli aus dem Feldlager in Schlesien gegeben. Bei der Eröffnung und ersten Aufführung stand der Kapellmeister im Ornate, in der weißen Allongeperücke und mit dem rotsammten Mantel vor dem Pult und entzückte seinen König mit seiner Schöpfung so sehr, dass er an die Markgräfin von Bayreuth schrieb: „er habe nie ein galanteres und prächtigeres Schauspiel gesehen und gehört“. Graun leistete in so kurzer Zeit schon Herrliches. Am 29. Dezember 1745 begrüßte ihn Graun mit seiner Triumphoper „Adriano in Siria“. Als im Jahre 1747 zu dem mit unendlicher Grazie, Geschmack und Feinheit singenden Salimbeni sich noch die große Künstlerin Signora Astrua gesellte und mit ihm im lebendigsten Wetteifer die Zuhörer begeisterte, da stand der Sieg der Berliner Oper über die Dresdener fest. Graun hatte mit Hilfe seines kunstsinnigen Fürsten den Preis davongetragen. 1746 erschien seine Oper „Cajo Fabricio“, welche Friedrich das Meisterwerk seines Kapellmeisters nannte; die 1747 zum Geburtstage der Königin Mutter komponierte Oper „Festa galanti“, nannte der König eine Oper, welche durch die Musik, durch die Stimmen, durch das Ballett, durch die Tänzer, durch die Dekorationen und durch die Statisten allen möglichen Erfolge hatte. Den 1. Januar 1748 folgte die Oper „Cina“, im Januar 1749 „Ifigenia in Aulide“. Von der ersten rühmt der König, dass sie einen großen Effekt auf der Bühne gemacht und der Erfolg ein allgemeiner gewesen sei; von der zweiten rühmt ganz Berlin mit Entzücken die Anmut und Lieblichkeit der Arien, die wie von der Liebe eingehaucht seien. 1752 schrieb Graun drei Opern: Britannico, Orfeo e Euridice und Giudizio di Paride. Bis zum Ausbruche des 7 jährigen Krieges schrieb Graun 1754 die Oper Semiramide, 1755 Montezuma und Ezio und 1756 Freatelli und Merope. Zur Semiramis, Montezuma und Merope hatte der König wiederum den Text selbst geschrieben, und von der Semiramis rühmt er, dass sein Kapellmeister alle Wärme, deren er fähig sei, hineingelegt habe. Die Oper Merope ist Grauns dramatischer Schwanengesang. Im Jahre 1758 kränkelte der Kapellmeister, sein naher Tod schien ihm gewiss zu sein. Mit welcher Freudigkeit er demselben entgegen ging, sehen wir aus der von ihm in seinen letzten Lebenstagen komponierten und zum Volksliede gewordene Arie über Klopstocks Lied: „Auf erstehn, ja auferstehn wirst du!“. 1759 den 8. August lag Graun am heftigen Brustfieber auf seinem Krankenlager. Da kam nach Berlin die Nachricht von dem verlorenen Treffen des Königs bei Kay; ganz Berlin ward in die größte Unruhe versetzt. Graun geriet bei dieser Trauerkunde so sehr in Aufregung und Betrübnis, dass er noch an selben Tage im Alter von 59 Jahren starb. Seine Leiche wurde in der Petrikirche beigesetzt. Das Te deum ein Werk zum großen Sieg über Prag, hat geschichtliche Bedeutung erlangt. Es wird allgemein behauptet, der König wäre bei seinen Einzug in Berlin am 30. März 1763 der harrenden Menge ausgewichen, sei heimlich in der Nacht in die Schloßkapelle gegangen, um selbst ganz allein das Te deum seines seit vier Jahren schon schlafenden Graun in heiliger Stille anzuhören und dem allmächtigen Gotte, der ihm so wunderbar geholfen, seinen Dank dar zubringen. Wenn auch Graun sich nicht neben seine Zeitgenossen Händel, Seb. Bach, Gluck, Haydn und Mozart als den Gleichen stellen wollte, so müssen wir ihm doch zugestehen, dass er in seinen Rezitativen bisher noch unübertroffen dasteht. Auch konnte der Kapellmeister bei aller Ehrerbietung da, wo er im Rechte war, fest stehen. Wenn die Erzählung, dass Graun dem Könige gesagt habe: „Ew. Majestät sind Herrscher in Preußen und ich der Herr der Kapelle“.
Auszug aus: Carl Heinrich Graun, der Sanges und Kapellmeister Friedrichs des Großen. Ein Lebensbild, bearbeitet von Cantor Wießner zu Wahrenbrück.
Das Graun-Denkmal zu Wahrenbrück, Geschichte desselben und Beschreibung der Enthüllungsfeier am 20. Juni
Im Februar v. J. schrieb wenige Tage vor seinem Tode, der Königlich Preußische Historiograph und Professor Dr. Erdmann Preuß zu Berlin an das Komitee zur Errichtung eines Denkmales für den Kapellmeister Friedrichs des Großen, Carl Heinrich Graun, in Wahrenbrück: „Es würde mir sehr schätzbar sein, wenn Sie mir zu meinem historischen Behufe eine kurze Geschichte Ihrer Komitee-Arbeiten und das Resultat Ihrer Sammlungen schenken wollten, da doch das Wahrenbrücker Unternehmen ein allgemeines Interesse erregt hat.“ Wenn hier der Anregung eines teuren Toten im weiteren Sinne Folge geleistet werden soll, so soll damit auch eine Pflicht der Dankbarkeit gegen alle Förderer des in Rede stehenden Unternehmens zur Erfüllung kommen. Im Jahre 1846 ward auf Anlass des Rektors Jülich zu Liebenwerda, das ein Stündchen von dem nur 800 Einwohner zählenden Städtchen Wahrenbrück entfernt liegt, vom Gesangvereine zu Liebenwerda der damalige Gesanglehrer des Gymnasiums zu Torgau, Cantor Beyer, um Aufführung eines Konzertes in der Wahrenbrücker Kirche zur Gründung einer Graun-Stiftung, welche hilfsbedürftige Musikstudirende unterstützen sollte, ersucht. Bald darauf wurden auch die „Siebenschläfer“ von Löwe, die Cantor Breyer eben eingeübt hatte, aufgeführt. Der Ertrag war 46 Taler, die in der Sparkasse zu Torgau niedergelegt wurden. Das Jahr 1848 mit seinen Folgen hemmte den Fortgang bis 1861. In dieser Zeit aber sammelte Kaufmann Burkhardt, Bürger zu Wahrenbrück, um sich die schlichten Ackerbürger des Städtchens und beschloss mit ihnen die Errichtung eines Graun-Monumentes, das vor dem Graunhause auf dem dortigen schönen, vom früheren Bürgermeister Hase mit einem Kreise von Kastanien geschmückten Platze errichtet werden sollte. Das Ministerium von Schwerin, Herr von Bethmann-Hollweg, Professor Dr. Preuß, Professor Grell in Berlin und der einzig noch lebende Nachkomme Graun's, Geheime Oberregierungsrat v. Korff zu Merseburg unterstützten das Vorhaben aufs Lebhafteste. Professor Preuß veröffentlichte 1862 Graun's Biographie (Bossische Zeitung), und die Königliche Sing Akademie zu Berlin (Professor Grell) führte zum Besten des Monumentes den „Tod Jesu“ im Jahre 1865 auf. Der Ertrag war 119 Taler. Der deutsche Krieg trat wieder störend in den Weg. Im Frühjahre 1867 ward jedoch die Angelegenheit mit vollen Kräften wieder in die Hand genommen. Die Komitees zu Liebenwerda und Wahrenbrück vereinigten sich und wählten für Wahrenbrück den hierher versetzten Cantor Wießner, für Liebenwerda den Rector Jülich zum Vorstande, die Kasse behielt Herr Burkhardt. Es wurde beschlossen, aus der bisherigen stillen Wirksamkeit in die Öffentlichkeit zu gehen. Der Cantor Wießner veröffentlichte im Liebenwerdaer Kreisblatte Graun's Biographie in populärer Form, die auch in der Euterpe Aufnahme fand, hierauf folgte am 29. September die feierliche Grundsteinlegung des Monumentes. Cantor Mautzsch zu Liebenwerda führte mit den Liebenwerdaer Sängern vor dem Enthüllungsakte den „Tod Jesu“ von Graun in der Kirche, da der Meister getauft worden ist, auf. Welch tiefen Eindruck diese schöne Aufführung des edlen Werkes machte, und wie schön die Tochter des Dirigenten, Tenorist Lehmann und der nun auch schon schlafende Diakonus Hinkel sangen, ist seiner Zeit berichtet. Die Festrede hielt der Cantor Wießner. Er beantwortete die Frage: „Welche Verdienste hat sich Carl Heinrich Graun erworben, dass ihm die Nachwelt ein Monument vor seiner Wiegenstätte errichten will, nachdem er bereits einen Ehrenplatz auf dem Monumente Friedrichs des Großen gefunden hat?“. Die Antwort war: „Er hat an der Seite Friedrichs des Großen dem Einzuge der klassischen Musik in Berlin und in Preußen überhaupt die Pfade vorzüglich ebenen helfen und selbst Werke geschaffen, die der Unsterblichkeit angehören. Professor Grell in Berlin sandte als Ausdruck seiner Freude zwei noch wenig bekannte Motetten Grauns: „Lasset uns freuen“ und „Herr, ich habe lieb“, und Professor Preuß schrieb: „Sie haben am Sonntage Alles geleistet, was dankbare Patrioten zu leisten vermögen. Ihre Festbeschreibung hat mich überrascht und mit wahrer Freude erfüllt. Ich habe den 28. und 29. viel an Wahrenbrück und Liebenwerda gedacht, mitunter des Regens wegen mit Schmerzen. Nun aber freue ich mit Ihnen und werde noch lange mit Hochachtung Ihrer würdigen Grundsteinlegung gedenken. Ihr Eifer und Ihre Weisheit werden in der Geschichte Liebenwerda's und Wahrenbrück's allezeit eine edle historische Tatsache bleiben.“ Er veröffentlichte seine Geschichte des „Todes Jesu“ zum Besten des Denkmals. Das Concert ergab 40 Taler Reingewinn. Mit der Berichterstattung über das Fest ward an die Dirigenten und Gesangvereine die Bitte gerichtet, in der nächsten Passionszeit bei der Aufführung des „Todes Jesu“ auch des Graun-Monumentes zu gedenken. Zwei betrübende Ereignisse schienen jedoch alle Hoffnungen zu zerstören. Zuerst erscholl der mächtige Notschrei aus Ostpreußen, der alle Herzen und Hände zu barmherziger Liebe und hohen Opfern aufforderte und alle Blicke nach jenen Gegenden richtete, dann starb der treueste Förderer des Werkes, der Professor Dr. Preuß, am 25 Februar 1868 im 83. Lebensjahre. Die Todesnachricht rief einen sehr wehmütigen Eindruck hervor. Am 17. Februar hatte der Verewigte noch ermunternd geschrieben und einige Zeilen seines Freundes, des General Leutnantes v. Webern beigefügt, jetzt schon schlummerte der Edle. In stiller Abendstunde traten die Komitee Mitglieder Wahrenbrücks zusammen, um das Andenken des Verewigten durch Vorlesung seiner Briefe zu ehren, und drückten ihr Beileid der Witwe des Dahingeschiedenen und dem Herrn General Leutnant v. Weber aus. Erstere schrieb zurück: „Sie haben durch Ihre freundliche Zuschrift einen Tropfen des Trostes mir in die Schale meines bittern Schmerzes gegossen. Herzlichen Dank für Ihre gütige Teilnahme, die meinem betrübten Gemühte sowohl getan hat.“ Sr. Exzellenz der Herr General Leutnant v. Webern schrieb: „Der Verlust, den wir Alle durch den trotz seiner 84 Jahre, viel zu frühen Tod meines teuren, treuen, trefflichen Freundes, des Professor Preuß erlitten haben, ist ein sehr großer. Für Ihre schöne Graun-Denkmals- Angelegenheit augenblicklich ein unersetzlicher, denn ich kenne Niemand, der bei dem besten Willen und Anlagen im Stande wäre, ihr so nützlich und wirksam zu sein, als der Verewigte es mit Herz und Sinn und Eifer gewesen ist. Verlieren Sie indessen keineswegs die Freudigkeit und Zuversicht. Ihr Werk, zu so edlem Zwecke begonnen und trotz aller Schwierigkeiten seitdem fortgesetzt, wird mit Eifer und Ausdauer auch zum erwünschten Ziele führen, trotzdem, dass die augenblicklichen Konjunkturen grade nicht die günstigsten sind, und die Tätigkeit und Wirksamkeit unsres heimgegangenen Freundes nützlicher und notwendiger als je jetzt gewesen sein würde. Meiner Teilnahme können Sie unter allen Umständen versichert sein.“ Ungeachtet dieser hemmenden Ereignisse ging das Werk rüstig vorwärts, der Graunsche Genius hat eine Feuerprobe der ernstesten Art bestanden, seine Freunde Nah und Fern haben ihn auch in den traurigsten Zeiten nicht vergessen. Selbstverständlich ist, dass nach den gebrachten großen Opfern für Ostpreußen, die Gaben geringer eingehen mussten. Direktor Paul Schnöpf zu Berlin führte die kleine Passion von Graun „Ein Lämmlein geht“ auf, der Kapellmeister Dr Hiller zu Cöln sandte 26 Taler, die er unter Kunstfreunden gesammelt hatte, Domorganist Franz Weber, Musikdirektor und Dirigent des berühmten Männer Gesangvereines zu Köln, hatte, obschon die Matthäus Passion von Bach und die Einleitungen zum bevorstehenden großen Kölner Musikfeste ihn vollauf beschäftigten, mit dem Männergesangvereine zu Köln und der dasigen Singakademie in einem ausgewählten Kreise zur wahren Freude der Zuhörer und hohem Genusse der Mitwirkenden den „Tod Jesu“ am Dienstag vor Ostern 1868 zu erhebender und äußerst gelungener Weise aufgeführt, um auch sein Scherflein (25 Taler) zu dem Monumente des großen Meisters beizutragen. Musikdirektor Rebling in Magdeburg sandte im Namen des Kirchenvereines zu Magdeburg 10 Taler, Ihre Majestät die Königin Auguste v. Preußen 25 Taler. Die Kreuzschule zu Dresden, wo Graun vorgebildet worden, der Gesangverein an der Elbe und Elster, der zu Herzberg, der Kreistag zu Liebenwerda, der frühere Abgeordnete Stephan zu Martinskirchen und auswärts wohnende Söhne Wahrenbrück's setzten mit ihren Gaben das Komitee in den Stand, zur Aufstellung des Monumentes schreiten zu können. Die Büste ward nach dem Modell des Professors Hugo Hagen (Rauch's Nachfolger) bereits in Lauchhammer meisterhaft in Bronce gegossen und das Postament nach Prof. Hagen's Zeichnung fertigte in poliertem Granit Bildhauer Spaarmann in Dresden. Der 20 Juni d. J. ward zur Enthüllungsfeier bestimmt. Die Einladungen ergingen an die Geschenkgeber und Freunde des Meisters. Der Musikdirektor Weber schrieb: „Wie gern wäre ich am 20. bei Ihnen, aber das Amt und der weite Weg halten mich zurück. Im Geiste jedoch bin ich in Ihrer Mitte. Haben Sie die Versicherung, dass ich mich bestreben werde, bald in Ihrem Städtchen zu erscheinen, um an die Stätte zu treten, da der große Meister Graun geboren ist, um hinzutreten vor sein Monument und zu sprechen: „Wie preise ich mich so glücklich, dass mir Gelegenheit geboten worden ist, zur Verherrlichung dieses großen Meisters ein Scherflein beitragen zu können.“ Dr. Hiller entschuldigte sich ebenfalls mit der Weite des Wegs. Am 19. Juni Abends 9 Uhr eröffnete der Cantor Wießner nach dem Zapfenstreich streich mit seinem Gesangvereine durch den Gesang der Motetten: „Der Herr ist König“ von Engel, „Herr deine Güte“ von Grell und „Auferstehn, ja auferstehn“ von Graun das Fest auf dem Markte des Städtleins. Die Jungfrauen und Jünglinge nebst den übrigen Bewohnern des Ortes hatten die Stadt aufs Schönste mit Kränzen, Girlanden und Ehrenpforten geschmückt. Am 20. Juni erschienen mitten im Regen die werten Gäste Berlins, Sr. Exzellenz der General Leutnant v. Webern und Professor Hagen, ferner der einzige noch lebende Nachkomme Graun's, der Geheime Oberregierungsrat von Korff aus Merseburg. Um 1.30 Uhr zogen die Komitee Mitglieder, die Schützengilde, die Jünglinge und Jungfrauen unter klingendem Spiele den lieben Gästen der Nachbarstadt Liebenwerda, der dasigen Schützengilde, Sängern und Sängerinnen, den Turnern und Komitee Mitgliedern entgegen. Nach der Einholung begrüßte sie der Bürgermeister Neumann mit freundlichen Worten vor dem Rathause. Um 2.30 Uhr riefen die Glocken ins Gotteshaus. Nachdem der Cantor Wießner eine Fuge von Seb. Bach (Es-dur) gespielt hatte, erhob der Cantor Mautzsch den Taktstock, und das Tedeum von Graun erscholl von den Sängern und Sängerinnen Liebenwerda's in der gefüllten Kirche. Die Aufführung übertraf alle Erwartungen. Die Chöre gingen sicher, die Soli waren trefflich, nicht minder die Instrumentalbegleitung des Stadtmusikus Koch von Liebenwerda. Den Preis trugen die Sopranistin Emma Mautzsch und Tenorist Lehmann davon, erstere zeigte, dass sie in Technik und Vortrag neue Fortschritte gemacht hatte. Unter andauerndem Regen versammelte sich der imposante Zug um 4 Uhr vor dem Rathause und bewegte sich nach dem Festplatze. Nach dem Gesange des Verses: „Sei Lob und Ehr“ hielt der Cantor Wießner, als Vorstand des Wahrenbrücker Komitees, die Weih rede mit kräftigen Worten. Hierauf folgte der Dank an die Geber und der Enthüllungsakt durch Actuar Hoppe zu Liebenau, dann die Übernahme Seitens der Stadt durch den Bürgermeister Neumann. Als den Gästen Berlins und Merseburgs ein Hoch gebracht war, sprach Sr. Exzellenz seine Anerkennung über das Monument aus und schloss mit einem Hoch auf den König, das mitten im Regen mächtig durch das mit vielen Gästen gefüllte Städtlein dahinbrauste. Kurze Zeit darauf fuhren die werten Gäste unter mächtigem Sängerhurrah der Heimat wieder zu. Den Rest des Tages verbrachten die Sänger und Sängerinnen im gemütlichen Beisammensein unter Sang und Tanz. Am andern Tage kehrten die Liebenwerdaer Freunde im festlichen Aufzuge, von den Wahrenbrückern eingeholt, wieder und umzogen im Sonnenschein das schöne Monument. „Das Fest“, so erscholl es aus aller Munde, „wird und unvergesslich sein!“ Auf die Bewohner seiner Vaterstadt schaut nun der große Meister Graun mit verklärtem Blick hernieder. Blickt man ihm so recht ins Angesicht, so ist es, als wolle er seinen Mund öffnen und holde Melodien seinem großen Könige singen. Dank allen, die das Denkmal förderten, besonders Dank dem Herrn Professor Hagen, der mit großer Uneigennützigkeit seine Kräfte dem schönen Werke gewidmet hat.
An diesem Text habe ich nur leichte Veränderungen vorgenommen.© A.Weinert all rights reserved.